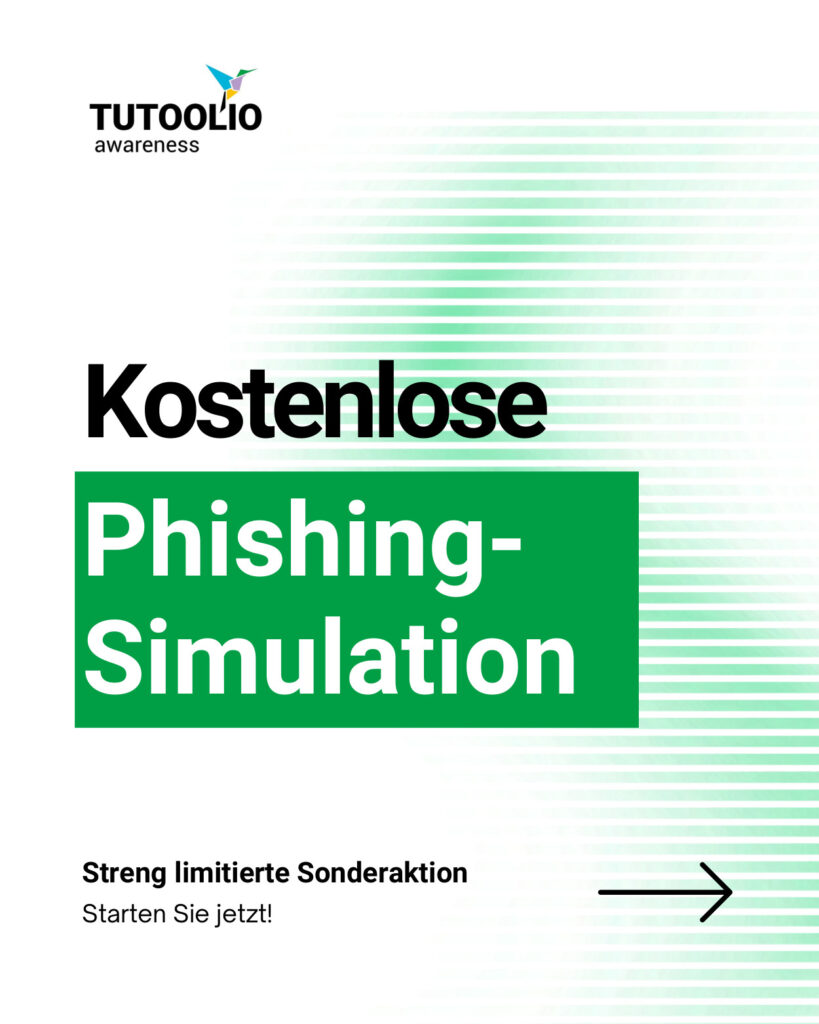Martin Blaschka über die innovativen Startups im Gesundheitswesen
Welche wichtigsten Vorteile sehen Sie dank innovativer Ansätze im Gesundheitsmarkt?
Ohne neue Ideen kann man als Ergebnis nur den Stillstand erwarten. Das kann auf sehr vielen Ebenen sehr gefährlich sein, da wir noch längst nicht am Ziel eines maximal nutzenbringenden und zugleich effizienten Gesundheitssystems stehen. Auf dem Weg dorthin brauchen wir junge Player mit frischen Ideen, die ihre Impulse in den Markt bringen – seien es neue, digitale Therapien oder Prozessoptimierungen in Klinken oder Krankenkassen.
Welches Interesse hat Ihre Organisation an solchen Lösungen?
Als wissenschaftliches Forschungsinstitut verbindet man das WIG2 sicher nicht instinktiv mit Startups oder Innovationen im Gesundheitssektor. Dennoch treiben uns diese Themen stark um. Jüngst haben wir sogar das Zentrum für Innovation und Netzwerk im Gesundheitswesen (ZING!) ins Leben gerufen, um zukünftig noch fokussierter unseren Teil dazu beitragen zu können, dass es neue Ideen in den Versorgungsalltag schaffen. Dafür unterstützen wir mit unserem jungen Team u.a. Startups bei der wissenschaftlichen Nutzenbewertung oder führen Innovationsveranstaltungen durch, um bspw. im Hackathon-Format neue vielversprechende Lösungen zu identifizieren.
Welche Vorgaben gelten bislang für den Einsatz von Innovationen in der Regelversorgung. Wie verlief der Prozess aus Ihrer Sicht?
Healthcare Startups können mit Lösungen auf ganz verschiedenen Ebenen einen positiven Impact für das Gesundheitssystem erzielen. Sicher, der „Königsweg“ war und ist es, mit einem neuen oder verbesserten Ansatz den Weg in die medizinische Versorgung zu finden. Doch dieser Weg ist lang und steinig; in die Regelversorgung sogar nahezu versperrt. Neben den ohnehin schon großen Hürden eines Startups, allen voran natürlich die eigentliche Produktentwicklung sowie eine gesicherte Startfinanzierung, müssen verschiedenste Akteure überzeugt und ggf. Zertifizierungen (bspw. CE-Kennzeichen bei Medizinprodukten) erlangt werden. Um dann den Schritt in die Regelversorgung machen zu können, wäre bislang noch ein umfangreiches und kostspieliges Antragsverfahren über den Gemeinsamen Bundesausschuss notwendig gewesen. Daher haben viele Startups eher den Weg über Partnerschaften in selektive Versorgungsangebote gesucht – bspw. über geförderte, regionale Forschungsprojekte oder Kooperationen mit ausgewählten gesetzlichen Krankenkassen.
Was ist/war daran unbefriedigend?
Für Startups gab es bislang keinen praktikablen Weg, es selbstständig und aus eigener Kraft in die Regelversorgung zu schaffen oder sich gar dort zu behaupten. Die erfolgsversprechende Lösung war stattdessen zumeist eine Kooperation mit einem Kostenträger, der das Potential des Produkts oder des Services erkannte und es für seine Versicherten auf Basis eines Selektivvertrags bereitstellen wollte. Ob dann tatsächlich positive Versorgungseffekte oder Struktur- bzw. Prozessverbesserungen durch die neue Lösung erzielt werden, wurde jedoch oft nur stiefmütterlich bzw. vorrangig aus Perspektive des jeweiligen Kooperationspartners analysiert. Der Gesamtblick auf die Versorgung fehlte indes häufig.
Wie wird diese Vorgehensweise neu aufgestellt?
Mit dem Digitale Versorgungs-Gesetz (DVG) hat es sich das Bundesgesundheitsministerium zum Ziel gesetzt, einen „Short Track“ in die Regelversorgung zu eröffnen. Ab Januar 2020 – soweit der Plan – soll es dann ein verkürztes Antragsverfahren über das BfArM geben mit einer Entscheidungsfrist von 3 Monaten. Bei Erfüllung aller Kriterien – das sind Grundanforderungen an Qualität, Sicherheit und Funktionstauglichkeit sowie positive Versorgungseffekte in Form eines medizinischen Nutzens bzw. einer Verfahrens- oder Strukturverbesserung – erfolgt eine Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis (Digitale Gesundheitsangebote nach dann §139e SGB V) und damit die Zulassung zur Regelversorgung. Sind die Kriterien nur teilweise erfüllt, eine volle Erfüllung jedoch erwartbar, kann auch eine probehalber Zulassung für 12 Monate erfolgen. In jedem Fall besteht damit eine realistische Chance für Startups, in die Regelversorgung zu kommen. Und das grundlegend unabhängig von selektiven Versorgungsverträgen. Die vielbeschworene „App auf Rezept“ kann dann tatsächlich Realität werden.
Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Eine der Voraussetzungen für die Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis ist der Nachweis eines medizinischen Nutzens bzw. einer Verfahrens- oder Strukturverbesserung aus Sicht des Patienten. Bereits im Rahmen des Antrags beim BfArM muss hierfür ein Evaluationskonzept eingereicht werden, das wissenschaftlich valide, plausibel und nicht zuletzt realistisch innerhalb von ein bis zwei Jahren umsetzbar ist. Mit dem ZING! arbeiten wir nun daran, unsere Kompetenzen als Forschungsinstitut in passende Leistungen für die wissenschaftliche Nutzenbewertung von innovativen Lösungen zu gießen. Da wir selbst noch junges Institut mit einem jungen, aber erfahrenen Team, mit agilen Ansätzen und einer großen Affinität zu digitalen Themen sind, freuen wir uns sehr auf die Möglichkeit, Startups auf diesem neuen Weg zu begleiten.
Wo sehen Sie weiterhin Hürden? Wie lassen sich diese überwinden?
Der mit dem DVG eröffnete Weg in die Regelversorgung wird den „Test der Zeit“ erst noch bestehen müssen. Unter anderem ist die Erfüllung aller benötigten Kriterien von einer hohen Finanzkraft abhängig. Für die Grundanforderungen müssen bereits Standards nachgewiesen werden, die der Medizinprodukte-Zulassung entsprechen. On top kommt die wissenschaftliche Nutzenbewertung – als Konzept und dann auch in der zwingenderweise eigenfinanzierten Durchführung. Ebenso müssen genügend Reserven vorhanden sein, um innerhalb der Probezeit in der Regelversorgung den gesamten operativen Market Access durchführen zu können. Wenn kein Leistungserbringer das digitale Gesundheitsangebot für seine Patienten verschreibt, wird nicht nur der Nutzennachweis schwierig. Ebenso sind einige der Kriterien noch wage – das BfArM selbst arbeitet derzeit noch an einem detaillierten und dann auch verbindlichen Katalog. Bleiben wir beim Beispiel der medizinischen Nutzenbewertung: Welche Studiendesigns mit welchen Methoden, Stichproben und Vergleichsgruppen werden durch die Zulassungsstelle akzeptiert, welche hingegen nicht?
Welche Rolle spielen elektronische Patientendaten in dieser Angebotslandschaft, welche Voraussetzungen sind hier ausschlaggebend (z. B. Interoperabilität/dazu gesetzliche Vorgaben)?
Die elektronische Patientenakte ePA soll zukünftig den Dreh- und Angelpunkt des deutschen Gesundheitssystems bilden. Unter anderem sollen die digitalen Gesundheitsangebote (DiGA) der Startups zwingend angebunden werden. Damit dieses Vorhaben gelingen kann, ist eine Interoperabilität der Systeme zwingend notwendig. Die Vergangenheit hat eindrücklich gezeigt, dass ein weiterer Flickenteppich an Insellösung nicht zur notwendigen Akzeptanz führen wird oder dazu, dass die Angebote auch tatsächlich genutzt werden. Im gleichen Atemzug ist es enorm wichtig, eine gute Balance zwischen selbstbestimmter Datenhoheit der Patienten und dem immensen Nutzenpotential zu schaffen. Ohne einem regulierten Zugang zu Gesundheitsdaten – primär für Forschungszwecke und schließlich sekundär auch für die Gesundheitswirtschaft – werden auch neue, bahnbrechende Erkenntnisse und darauf aufbauende Gesundheitslösungen ausgebremst. Andere europäische Länder, beispielsweise die Niederlande, konnten im letzten Jahrzehnt bereits zeigen, wie Patienten aktiv in die Weiterentwicklung eines Gesundheitssystems einbezogen werden können und welche Qualitätssteigerungen in der Versorgung dadurch bereits erzielt werden konnten.