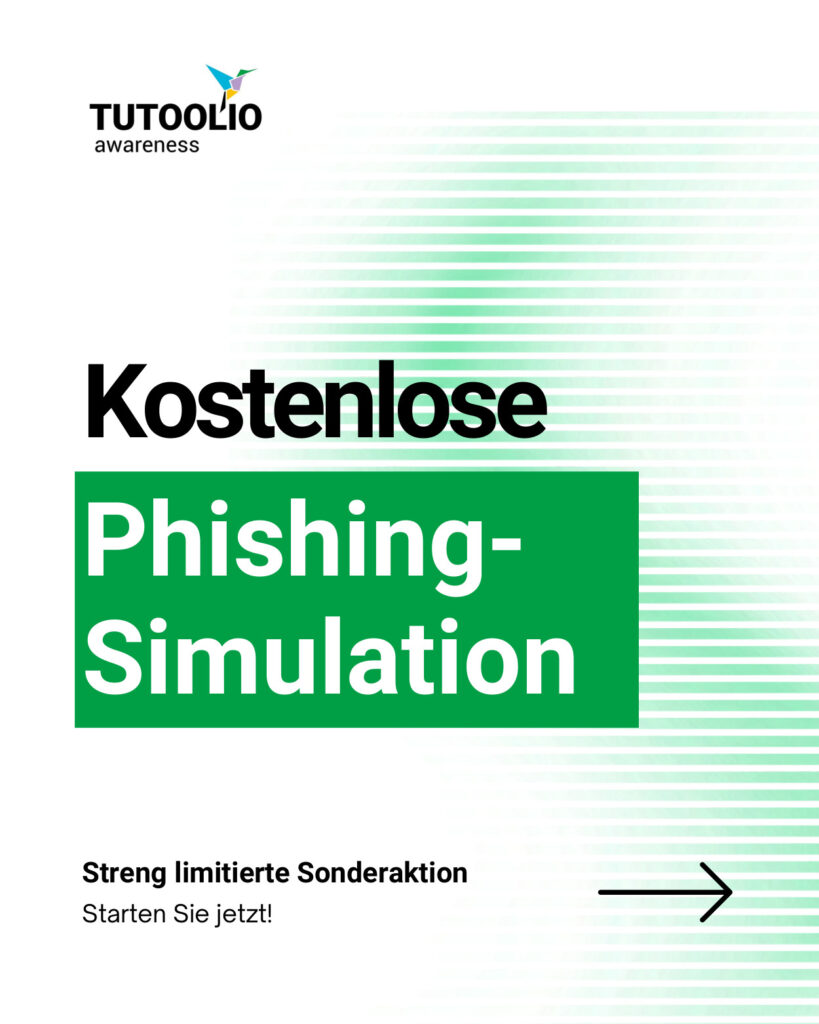Ein Roboter in der Apotheke, künstliche Intelligenz in der Diagnostik, Datenaustausch statt Datensilos: Das Uniklinikum Essen gilt als Vorreiter der digitalen Transformation im Krankenhaussektor. Von den Erfahrungen sollen künftig noch stärker auch andere Kliniken profitieren.
Von Martin Lechtape
Mathilde mischt Medikamente so präzise wie niemand sonst im Universitätsklinikum Essen. In der Apotheke des Krankenhauses ist sie so etwas wie der Star der Belegschaft: Sie wiegt einzelne Bestandteile haargenau ab, ohne einen Fehler zu machen, ohne je etwas zu verschütten oder einen Bestandteil zu vergessen. Mathilde Dosenfänger – so nennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhausapotheke in Essen ihren Roboter, der Medikamente für Chemotherapien mischt. Erwartet das Krankenhaus einen Krebspatienten zur Chemotherapie, schicken die Ärzte eine genaue Anweisung mit dem Medikament an die Apotheke. Die Apothekerinnen und Apotheker geben die Bestellung in das System ein und gewähren Mathilde Zugriff auf die Daten aus der digitalen Patientenakte: Größe, Gewicht, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten – das alles berücksichtigt der Roboter, wenn er die personalisierten Medikamente in einer sterilen Kabine mischt, die ungefähr so groß ist wie eine Gefriertruhe.
Auch andere Bereiche des Uniklinikums Essen sind inzwischen zu großen Teilen automatisiert: Die Notaufnahme gilt als eine der modernsten Europas. Rettungswagen schicken Informationen zum Zustand des Patienten schon während der Fahrt zur Klinik an die Ärzte in der Notaufnahme – die sich so rechtzeitig auf den Zustand des Patienten einstellen können. Ein digitaler Pförtner am Eingang zur Notaufnahme erkennt durch eine Kamera das Nummernschild des Rettungswagens und öffnet automatisch die Schranke. In der Notaufnahme bekommen Patientinnen und Patient einen kleinen weißen Kasten, der über das WLAN mit dem Krankenhausnetz verbunden ist und alle Daten und Untersuchungsergebnisse speichert. Dass Informationen falsch oder unvollständig erfasst werden – was bei handschriftlichen Notizen schon einmal passieren kann – wird so ausgeschlossen. Blut- oder Urinproben aus der Notaufnahme werden über eine Art Rohrpostsystem in das 500 Meter entfernte Zentrallabor geschickt. Die Ergebnisse werden den Medizinerinnen und Medizinern nach 30 Minuten digital angezeigt.

Innovationen wie diese haben zum Ruf des Uniklinikums Essen als Vorreiter der digitalen Transformation im Klinikbereich beigetragen. Den Grundstein dafür legte 2015 der damals neue Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende Professor Jochen A. Werner mit einer Smart-Hospital-Strategie. Seitdem hat das Uniklinikum viel Geld in die Digitalisierung und Automatisierung investiert. Zuletzt flossen 63 Millionen Euro in den Bau von acht smarten Operationssälen, in denen Virtual- und Augmented-Reality-Technologien zum Einsatz kommen. Die Gelder für den Neubau und die Einrichtung stammen vom Land Nordrhein-Westfalen.
Eine weitere Förderung in Höhe von 5,8 Millionen Euro bekamen die Essener über die Initiative SmartHospital.NRW. Mit dem Geld will das UK Essen den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) weiter erproben: So soll zum Beispiel ein Texterkennungssystem entwickelt werden, das Patientenakten liest und wichtige Informationen für den zuständigen Arzt auf einen Blick zusammenfasst. Ärzte müssen dann nicht mehr die ganze Akte durchblättern und haben mehr Zeit für die Behandlung der Patientinnen und Patienten.
Auch Pflegekräfte sollen von der Digitalisierung profitieren. „Hol- und Bringdienste machen rund ein Drittel der Arbeit von Pflegepersonal in Krankenhäusern aus“, sagt David Matusiewicz, Professor für Medizinmanagement an der FOM Hochschule. Roboter, die zum Beispiel die Essensverteilung übernehmen, könnten Pflegekräfte entlasten und die Arbeit attraktiver machen, erklärt Matusiewicz. Das komme auch Patienten zugute. In Essen wird das Pflegepersonal hingegen durch andere Technik entlastet, zum Beispiel mithilfe von intelligenten Lagerungsmatten. Diese erkennen, ob ein Patient es schafft, sich selbst umzulagern. „Liegt ein Patient für drei oder vier Stunden auf einer Stelle, gibt das System dem Pflegepersonal einen Hinweis, dass der Patient umgelagert werden muss“, sagt Anke Diehl, Chief Transformation Officer und Leiterin der Stabsstelle Digitale Transformation am Universitätsklinikum Essen.
Die Essener setzen auch in der Diagnostik stärker auf Digitalisierung. Sie haben ein eigenes Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) aufgebaut und setzen beispielsweise KI in der Röntgendiagnostik ein. Im Gegensatz zum Menschen übersehen die Systeme kein Detail in Aufnahmen, wenn sie gut mit Daten trainiert wurden. „KI-gestützte Auswertungen von Tumorgrößen bei Krebserkrankungen bilden Größenveränderungen sehr genau ab“, sagt Diehl. Dies fördere die Effizienz, steigere die diagnostische Sicherheit und somit auch die Patientensicherheit. Ärzte könnten so schneller eine Diagnose stellen und möglicherweise auch schneller mit einer Therapie beginnen.
So revolutionär die Technologie und der Traum vom Smart Hospital auch sind, viele deutsche Krankenhäuser sind von einem digitalisierten und stärker automatisierten Betrieb wie in Essen noch weit entfernt – nicht zuletzt, weil die Gelder für Investitionen fehlen und Fördergelder wie für das Essener Klinikum eher die Ausnahme statt die Regel sind. Im DigitalHealth-Index der Bertelsmann Stiftung belegt Deutschland daher im Vergleich mit 16 anderen Ländern nur den vorletzten Platz. Kein Wunder: Hapert es in Deutschland doch schon an der Digitalisierung einfacher, alltäglicher Prozesse.
Und der Investitionsstau verursacht viele weitere weitreichende Probleme: „Deutsche Krankenhäuser haben noch zu viele Datensilos, die nicht miteinander verbunden werden“, sagt Matusiewicz. In der Regel habe jede Abteilung ihr eigenes digitales System. Das erhebt zwar allerlei Daten, kann aber nicht mit anderen Systemen kommunizieren. „Die existierenden digitalen Ansätze sind viel zu oft Insellösungen, bei denen eine langfristige Strategie fehlt“, bemerkt der Professor für Medizinmanagement.
Das Uniklinikum Essen hat deshalb nicht nur frühzeitig eine Strategie, sondern auch ein übergeordnetes System eingeführt, das dem Personal bei entsprechender Berechtigung den Zugriff auf Daten aus allen Abteilungen ermöglicht. „So kann das Personal digital Daten aus verschiedenen Abteilungen einsehen, ohne durch das ganze Krankenhaus laufen zu müssen“, sagt Digitalisierungschefin Diehl, die im November von der Jury des German Medical Award als Medizinerin des Jahres ausgezeichnet wurde.
Die Ärztin will ihr Wissen nun an Kolleginnen und Kollegen anderer Krankenhäuser weitergeben. Im Rahmen des KI-Spitzenclusters SmartHospital.NRW des Landes NRW entwickelt Diehl mit ihren Kollegen nicht nur KI-Anwendungen. Sie erstellen auch einen Leitfaden, der anderen Krankenhäusern als Anleitung zur digitalen Transformation dienen soll. Zudem wollen die Essener in einem sogenannten Showroom die KI-Prototypen vorstellen und in Kooperation weiterentwickeln. „Wir gehen auch in andere Krankenhäuser, um die Transformationsmodelle zu testen. So können wir andere Kliniken mit unserem Wissen unterstützen und zeigen, was schon alles möglich ist“, sagt Diehl.
Doch inwiefern lassen sich die Essener Technologien überhaupt auf andere Krankenhäuser übertragen? „Natürlich können kleine Krankenhäuser mit begrenzten Ressourcen nicht dasselbe in der gleichen Geschwindigkeit umsetzen wie die großen Vorreiter“, sagt David Matusiewicz. Darum gehe es aber auch nicht. „Große Häuser, wie das Universitätsklinikum Essen, gehen voran und zeigen, was möglich ist.“ Die Kleinen hätten dann die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Technologie ihnen helfen könnte und welche vielleicht auch nicht. „Es geht im übertragenen Sinn darum, einen Arztkoffer zu entwickeln, aus dem sich Krankenhäuser einzelne Instrumente, ihren Möglichkeiten entsprechend, aussuchen können“, sagt Matusiewicz. Letztlich kann somit jede Klinik zu einem Smart Hospital werden – jede auf ihre eigene Weise.