Radikale Vereinfachung ist oft die schwierigste Disziplin überhaupt. Ein Prinzip der Design-Thinker lautet jedoch: Do less! Ein anderes: Do the hard work to make it simple. Beide Prinzipien haben auch außerhalb der Design-Thinking-Welt Gültigkeit
Von Stefan Deges
Inhalt
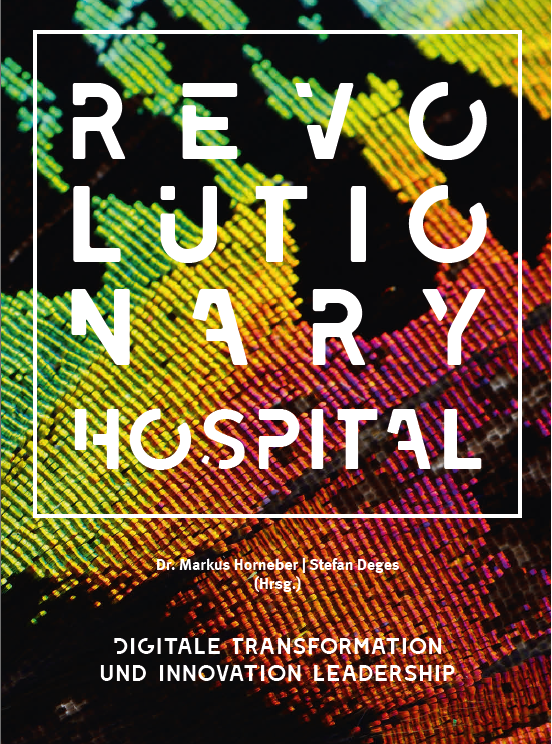
Dieser Beitrag basiert auf dem Kapitel „Kundenorientierung und Patientenzentriertheit“ meines Buchs „Revolutionary Hospital Digitale Transformation und Innovation Leadership“.
Copy & Paste: das Rad nicht neu erfinden
Die besten Ideen kommen oft nicht von den Experten im eigenen Haus, sondern von Menschen aus ganz anderen Disziplinen und Branchen. Forscher der Wirtschaftsuniversität Wien haben das empirisch belegt, indem sie Experimente mit 213 Tischlern (sind oft giftigen Dämpfen und Staub ausgesetzt), Dachdeckern (arbeiten in luftiger Höhe) und Skatern (akut sturzgefährdet) durchführten. Dabei kamen die beiden jeweils fremden Gruppen zu den kreativeren Lösungen für die eigenen Herausforderungen. Diese Ideen sind zwar nicht immer absolut passgenau wie die aus der eigenen Profession, aber unter dem Strich überwog der Vorteil der größeren Kreativität (Franke et al. 2014).
Wenn Fehler Leben kosten, ist höchste Zuverlässigkeit geboten. Das ist ein wesentliches Kennzeichen von Risikoorganisationen. Aber es gibt auch Hochzuverlässigkeitsorganisationen (komplex, herausfordernd, eng gekoppelt, hoch gefährlich) wie Atomkraftwerke, Ölbohrinseln oder große Investmentbanken. Die dortigen Anforderungen sind eher noch höher als jene im Krankenhaus. Von Ersteren lässt sich folglich einiges lernen. Es lohnt sich auch dann, Einblick in die Abläufe und Usancen anderer Branchen zu nehmen, wenn sie nicht als Hochzuverlässigkeitsorganisationen gelten. Dafür können der Einfachheit halber Experten zu Vorträgen eingeladen werden. Noch lehrreicher allerdings ist es, gelegentlich einen Ausflug zu planen. Innovations- starke Kliniken machen genau das. Sie bauen ihre Innovations- und Kreationsfähigkeit aus, indem sie Hospitanzen bei Start-ups und Unternehmen anderer Wirtschaftszweige einplanen. Dort finden sie abwegige und manchmal auch banal-geniale Lösungen.
- Im Atomkraftwerk steht das Fehlerbewusstsein im Berufsalltag ganz oben auf der Tagesord- nung.
- In der Hotellerie lässt sich viel zur Serviceorientierung lernen.
- Die Luftfahrt verrät Nützliches zu Team-Briefing und De-Briefing, Checklisten und Time-out, aber auch zur sensiblen Kommunikation zum Beispiel mit ängstlichen Patienten.
- Ein Probentag mit einem Orchester gibt Aufschlüsse in Sachen Führung und Teamwork.
- Unternehmen, die vor einiger Zeit eine ernste Krise zu managen hatten, können viel über das eigene Krisenkommunikationssystem (Krisenhandbuch, Dark Sites, Krisenstab etc.) vermitteln.
- Start-ups, auch branchenfremde, dienen als Vorbild für Komplexitätsreduktion und Konzentration auf zentrale unternehmerische Herausforderungen.
Ein Beispiel aus Kalifornien: Sutter Health ist einer der regelmäßigen Gäste auf der Liste von „Becker’s Hospital Review“. Und das, obwohl der kalifornische Gesundheitsanbieter offen ein- räumt, Ideen abzukupfern. Chris Waugh, der Chief Innovation Officer von Sutter Health, gab auf dem Amerikanischen Krankenhausmanagementkongress 2017 öffentlich zu Proto- koll, woher die Inspiration stamme: „Health Care beginnt, das Silicon Valley nachzuahmen. Unternehmen stellen Chief Innovation Officers an, finanzieren sich über Wagniskapital und gründen Innovation Labs.“ Waugh und Sutter orientieren sich an den digitalen Vorreitern aus dem Valley, die sich mit kundenorientierter Denkweise nach oben gearbeitet haben. Konkret ließ Waugh sich bei der Frage helfen, warum so viele Patienten Arzttermine versäumen. Sutter Health muss nach jedem verpassten Termin das klinische Personal neu planen. Also entschloss sich das Management, genau zu erfassen, warum Patienten so oft Termine platzen lassen, was sie erleben, bevor sie das Krankenhaus erreichen. Oft sind es offenbar Transportprobleme, die Patienten verspätet oder überhaupt nicht beim Arzt vorsprechen lassen.
Wie also kann man den Transport verbessern? Sutter suchte Rat bei Lyft, dem Uber-Konkurrenten, der nur wenige Kilometer entfernt vom Sutter-Stammsitz beheimatet ist. Man lernte: Mit einer webbasierte Concierge-Plattform erhielten Patienten einen besseren Zugang zu Arzt-Terminen. Und damit nicht genug: Warum sollte Sutter den Service neu auflegen, wenn Lyft ihn bereits ausprobiert? Wenn heute Kunden von den Registrierungs-, Terminplanungs- und Pflegeberatungsdiensten des Healthcare-Providers einen Patientenbetreuer bitten, die Concierge- Plattform von Lyft nutzen zu dürfen, wird ihnen prompt eine Fahrt reserviert. Die Patienten werden per SMS über die Identität und Ankunft des Fahrers informiert, und die medizinischen Dienstleister können auf einem Dashboard Zeitpunkt und Status der Fahrt verfolgen.
Ein anderes Beispiel, ebenfalls aus dem Hause Sutter Health: Angeschlossene Ärzte suchten einst nach einem Weg, um sich während der Untersuchungen nicht so oft und lange für Dokumentationen vom Patienten abwenden zu müssen. Die Lösung fanden sie in der Augmented Reality, und zwar bei einem Start-up names Augmedix. Gemeinsam haben Sutter und Augmedix eine Brille entwickelt, die während einer Behandlung wesentliche Informationen aus der Patientenakte aufspielt. Die Dokumente werden mit der Stimme angesteuert. Ein semantisches Erkennungsprogramm (Scribes) ergänzt die Spracheinträge automatisch. Durchschnittlich spart ein Arzt zehn Stunden Dokumentationszeit in der Woche.
Zugegeben, der Sitz von Sutter Health in Kalifornien hat den angenehmen Nebeneffekt, dass einige der innovativsten Unternehmen der Erde nur eine Garage weiter gegründet wurden. Man kennt sich im Valley. Aber auch in Deutschland sprießen fokussierte, innovative Neugründungen wie Pilze aus dem Boden. Eine Hospitanz lohnt sich gewiss.
Der Alles-aus-einer-Hand-Irrweg
Die Digitalisierung bringt stetig neue Techniken und Angebote hervor, die das bestehende Geschäft in die Bredouille bringen. Den Verlagen geht es da nicht anders als den Krankenhäusern. Der Bibliomed-Verlag wuchs einst mit der Pflege auf und erweiterte sein Angebot mit den Jahren auf das Klinikmanagement und das medizinische Personal. Der Anspruch lautet bis heute, Trends aufzuspüren, Hintergründe zu erläutern, Fachwissen gut verständlich aufzubereiten und damit die unterschiedlichen Berufsgruppen im Arbeitsalltag zu unterstützen.
Diesem Anspruch will der Verlag auch in der Digitalisierung gerecht werden, weshalb man sich auf die Suche nach einem adäquaten Wissensangebot für die digitale Welt machte. Design Thinking war dabei die Methode der Wahl. Bibliomed trug in Umfragen und Marktforschung die Wünsche und Vorlieben der Pflegenden zusammen und erkannte, was auch viele Kliniken heute in Mitarbeiterbefragungen herausfinden: Attraktive Weiterbildungs- und Fortbildungs- formate stehen in der Pflege hoch im Kurs. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Unternehmen, die ihre Arbeitgeberattraktivität aufbessern wollen, diesen Wunsch der größten Berufsgruppen bedienen müssen.
So entwarf Bibliomed eine Lernplattform für die Pflege: Bibliomed Campus. Inhalte, Formate und Usability wurden in enger Zusammenarbeit mit den späteren Nutzern entwickelt: kurzweilige, didaktisch hochwertige, ästhetisch stilprägende Lerneinheiten für alle Endgeräte. Bei der Entwicklung wurden auch die Präferenzen von Klinik-Geschäftsführern berücksichtigt, die insbesondere auf eine Reihe von Pflichtunterweisungen Wert legten.
Inzwischen hat Bibliomed Campus in mehr als 200 Krankenhäusern und rund 60 Reha- beziehungsweise Altenhilfeeinrichtungen vorgesprochen. Knapp 50 Mal wurde gepitcht. In der Regel kam der Kontakt über die Pflegeleitung oder die Geschäftsleitung zustande, die jeweils mit den Magazinen des Verlags beruflich groß geworden sind und entsprechend großes Vertrauen in die Qualität der Bibliomed-Inhalte besaßen. Vor Ort bei den Präsentationen gewinnt Bibliomed dann ein Bild, wie im Krankenhaus aus den ursprünglich einmal eindeutigen Anforderungen an Format, Inhalt und Usability eine hochkomplexe Einkaufsentscheidung wird, die sich zusehends vom ursprünglichen Ziel entfernt. Im Buying Center entwickelt sich ein multidisziplinäres Gruppenspiel, das sich mit Inhalten und Formaten allenfalls noch am Rande befasst. Task Forces, Projektmanagementteams und standort- sowie disziplinenübergreifende Meetings verkomplizieren die Entscheidungsfindung. Pflegedirektionen nehmen immer seltener teil, Geschäftsführer werden kaum mehr gesehen. Am Ende steht ein IT-Projekt besonderer Güte. Kommt es dann zur Ausschreibung oder auch nur zu einem ausformulierten Anforderungskatalog, so ist von der eingangs formulierten Erwartungshaltung (attraktive Bildungsmedien, rechtssichere und bündige Pflichtschulung) nicht mehr viel übrig. Anforderungen an die Lerninhalte spielen laut einer Auswertung von Bibliomed nur noch in 14 % aller Kriterien eine Rolle. Wichtiger sind Anforderungen an das Lernmanagementsystem (36 %) und vor allem die IT, die für die Hälfte aller Kriterien sorgt.
In den meisten Fällen dauert es vom Pitch über das erste Signal der Klinik, Bibliomed Campus implementieren zu wollen, bis hin zur (Vorstands-)Entscheidung mehr als ein Jahr. Und eine Entscheidung ist noch kein Vertrag; ein Vertrag kein Fahrplan; ein Fahrplan keine Implementierung; eine Implementierung noch keine Schulung, eine Schulung noch kein kundiger oder zufriedener Mitarbeiter.
Das Ganze ginge wesentlich einfacher, insbesondere, wenn ein Krankenhaus ein eindeutig identifiziertes Problem wie zum Beispiel eine Brandschutzschulung zu lösen hat. In vielen Krankenhäusern jedoch wächst schnell der Wunsch nach einem Komplettsystem. „Wir hätten am liebsten alles aus einer Hand“, lautet ein Wunsch, der im Buying Center geäußert wird. Insellösungen sind offenbar so verpönt wie blutige Entlassungen. Aus irgendeinem Grund gilt es, Schnittstellen außerhalb von OP-Sälen zu vermeiden. Ein System muss alles mitbringen – wie anno dazumal beim Krankenhausinformationssystem.
Auf die Implementierung von E-Learning übertragen bedeutet dies, ein Anbieter muss gleichzeitig Lernmanagementsystem, Personalverwaltungssoftware, Seminarprogramme und ausformulierte Lerneinheiten – vorzugsweise für alle Berufsgruppen – mitbringen. Das alles muss auf dem Server der Klinik laufen, permanent update-bar sein, mit 24-Stunden-Supportfunktionieren und bestenfalls sind die Lerneinheiten individuell auf jede einzelne Klinik zugeschnitten.
Die Digitalisierung, eine eierlegende Wollmilchsau? Theoretisch möglich. Würde aber ernsthaft jemand in ein Möbelhaus gehen, um Regalwände, personalisierte Zeitungen und Fachbücher aus einer Hand zu kaufen, samt Aufbau-, Wartungs- und Reparaturservice?
Do less!
Und: Do the hard work to make it simple.
Make it easy
Chris Waugh von Sutter Health wäre nicht auf Lyft zugegangen, wenn sein Unternehmen alles aus einer Hand hätte haben wollen. Im Gegenteil, Innovation Leader verstehen es mustergültig, passechte Lösungen zu implementieren, die bestehende Angebote ergänzen. Zugriff auf Plattformen ersetzt das Komplettsystem. Mit der Entscheidung für ein Produkt oder eine Dienstleistung müssen nicht alle Probleme einer Abteilung gelöst sein. Klein anfangen und konfektionieren kann der bessere Weg sein. Warum gleich die ganz große Lösung anstreben, wenn eine Testphase im kleinen Maßstab wertvolle Erkenntnisse liefert?
Im Softwarebereich ist die Strategie „Kleine Einheiten und Module bilden“ längst ausgereift. Kunden kaufen Basislizenzen und upgraden weitere Funktionalitäten je nach Bedarf. User sollten sich anfangs nicht mit allen (unnötigen) Funktionalitäten auseinandersetzen, sondern zunächst ihr Kernanliegen überprüfen. Um das Beispiel von der Einführung eines E-Learnings noch einmal aufzugreifen, bei dem die eigenen Mitarbeiter die User sind: Wer den Wunsch der Pflege erfüllen möchte, attraktive Bildungsmedien nutzen zu können, benötigt kein umfassendes Lernmanagementsystem, sondern kann die E-Learnings „easy“ per Web-Zugang zur Verfügung stellen. Kein Systemadministrator ist dafür erforderlich, der den Pflegenden Kurse zuordnet oder Zertifikate verwaltet. Die Kollegen können nach eigenem Gusto entscheiden, wie oft und in welchem Umfang sie Kurse belegen.
Und es geht tatsächlich noch einfacher. Aus dem Lean-Start-up-Konzept von Eric Lies ist das MVP bekannt, das Most Viable Product: Es handelt sich dabei um ein rudimentäres Produkt, das nur mit den Mindest-Features ausgestattet ist, ohne die ein Launch nun wirklich nicht funktionieren würde. Die Lösungen für das Problem E-Learning-Pflichtunterweisungen zum Beispiel kann mit einem MVP erreicht werden: Schulungen ohne jede Schnittstelle zur Personalsoftware lassen sich innerhalb von wenigen Wochen implementieren und erreichen in Rekordzeit eine nahezu hundertprozentige Schulungsquote. Es müssten noch nicht einmal Personaldaten das Krankenhaus verlassen, und ein komplexes Lernmanagementsystem ist ohnehin nicht erforderlich, um in Windeseile alle Mitarbeiter einer Pflichtunterweisung zu unterziehen (Campus 2018).
Quellen:
- Franke et al. 2014: Franke, Nikolaus, Pötz, Marion, Schreier, Martin 2014: Integrating problemsolvers from analogous markets in new product ideation. Management Science (MS) 60 (4):S. 1063–1081.
- Campus 2018: https://campus.bibliomed.de/bibliomed-basics/








