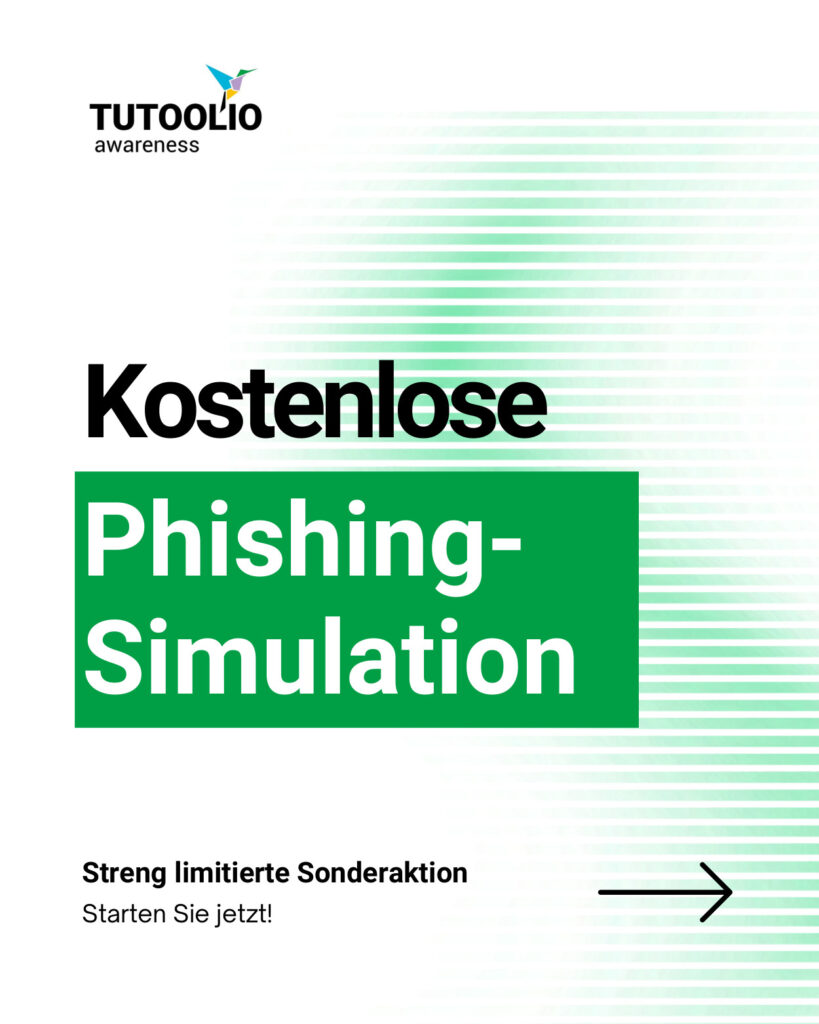Mit dem Digitale Versorgung-Gesetz dürfen Krankenkassen sich künftig auch finanziell in Start-ups engagieren. Mehr noch als Investitionsmittel aus dem Topf der Versicherten beten innovative Jungunternehmen aber einen kulturellen Wandel in der Branche herbei.
Ein Essay von Frank Stratmann
Der schillernde Begriff Start-up scheint im Wortschatz des deutschen Gesundheitswesens angekommen zu sein. Kaum ein Kongress verzichtet auf einen Schluck aus dem Jungbrunnen jener aufstrebender Geschäftsmodelle, von denen das Gesundheitswesen so viel lernen könnte. Wir erleben serielle Start-up-Pitches, die zwischenzeitlich inflationär zu einem grotesken Schaulaufen verkommen, weil selten mehr als Voyeurismus zu beobachten ist. Egal ob sich Startups schon konkret als medizinische Anwendung präsentieren oder sich peripher organisatorisch ins Patient-Arzt-Verhältnis einmischen. Eine nähere Betrachtung zeigt, wie unreif der seniorige Umgang mit den jungen Hoffnungsträgern tatsächlich ist.
Kulturelle Asymmetrien sorgen für einen zu respektablen Abstand zwischen beiden Welten. Das muss sich ändern, wenn das deutsche Gesundheitssystem sich zukunftsfähig halten und auf die in diesen Jahren von außen wirkenden Dynamiken der Veränderung geeignete Antworten finden will. Der medizinische Fortschritt organisiert sich in einer globalisierten Welt international. Auch hierzulande entstehen wichtige Ideen vor allem nicht mehr deshalb, weil den deutschen Versicherten mit ihren Bedürfnissen nach bester medizinischer Versorgung isoliert begegnet werden soll. Das deutsche Gesundheitssystem mit neuen Ideen zu durchlüften hieße, sich als Teil eines Welt-Gesundheitssystems zu verstehen und die Rolle anzunehmen, Zukunftsmedizin unter Berücksichtigung junger Ideen gestalten zu wollen. In der Vergangenheit empfanden deutsche Start-ups das deutsche Gesundheitswesen manchmal als derart behäbig, dass sie hier ihre Zelte abbrachen, um ausgestattet mit Kapital vom schnell gegründeten New Yorker Büro aus die Welt zu erobern. So zu beobachten bei Goderma, die heute Klara heißen und mit dem Gang in die USA gleich noch eine Mutation ihres Geschäftsmodells angingen. All das, weil Gründerwille und Vorankommen an der Akzeptanz im deutschen Gesundheitsmarkt fast verzweifelt wären. Auch deshalb ist der aufgeschlossene Umgang – gerade mit neuen, aufstrebenden und vielversprechenden Geschäftsmodellen – so wichtig.
Auf Akteure des auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebauten Gesundheitswesens wirkt die Welt der Start-ups etwas spukhaft. Wer die Verschiedenheiten auf beiden Seiten schon etwas länger beobachtet oder moderiert, weiß um die schwierige Vereinbarkeit. Ein wenig erinnert das alles an ein anderes, noch ungelöste Problem: die Welt der Quantenphysik mit den Berechnungen der Astrophysik zu vereinbaren. Das Universum des ganz Kleinen will nicht so recht zu dem ganz Großen passen. Beides liegt naturgemäß ziemlich nah beieinander. In Anbetracht raumzeitlicher Dimensionen dann wieder ganz weit auseinander. Doch beides wurde uns in die Welt gestellt. Die Formel für eine Harmonisierung der Vorstellungskräfte wird noch gesucht.
Das Bundesgesundheitsministerium hat seiner Auffassung nach eine Formel gefunden, die Welt aufstrebender, digitaler Lösungen mit dem Kampfstern des Gesundheitswesens zusammenzubringen. Das Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) will Wurmloch sein für die Zukunftsmedizin. Das deutsche Gesundheitswesen soll nach Vorstellung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ein Upgrade erhalten, um so den Paradigmenwechsel zu schaffen und sich beispielsweise die vielen seriösen Gesundheits-Apps zu Nutze machen. Zum einen dürfen geeignete Gesundheits-Apps demnächst durch einen Arzt verschrieben werden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten. Zum anderen sollen sich Krankenkassen diesen neuen Ideen mit Kapital anschließen dürfen. Bis zu zwei Prozent ihrer Rücklagen dürfen Krankenkassen verwenden, um sich finanziell zu engagieren. In Anbetracht von 21 Milliarden Euro an Rücklagen stünden zumindest theoretisch 420 Millionen Euro für ein mögliches Investment-Lotto der Kassen zur Verfügung. Ein Damm indes bricht damit noch nicht. Den Kommentierungen des Ministeriums des zweiten Referentenentwurfs, der so vom Kabinett am 10. Juli 2019 beschlossen wurde, folgende Empfehlung zu entnehmen ist: „Für den Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen kommen insbesondere auf Gesundheitstechnologien spezialisierte Fonds in Betracht, die eine zunehmend wichtige Rolle bei der Förderung der Entwicklung digitaler Innovationen für die Gesundheitsversorgung spielen.“
Übersetzt heißt das wohl, dass eine Investition eher dort angeraten wird, wo möglichst viele Versicherte profitieren würden. Das Investment einer Krankenkasse in ein einzelnes Start-up wäre wohl an der Idee für einen Paradigmenwechsel vorbei. Oft widmen sich medizinische Start-ups einer einzelnen Fragestellung im Umgang mit einzelnen Krankheiten. Ganzheitliche Ansätze fehlen im Start-up-Segment häufig genauso wie in der wissenschaftlich geprägten Medizin.
Was Start-ups an Kraft aufbringen
Frank Trautwein ist Geschäftsführer eines in Leipzig ansässigen Unternehmens, das sich selbst noch als Start-up sieht und der Definition nach auch wäre. Wenn da nicht die Vorgeschichte des Gründers wäre, die ihn über die Medizintechnik in die Welt der klinischen Studien und damit auf das Feld der künstlichen Intelligenz führte. Von hier aus entwickelte der ehemalige Ingenieur, der einen Teil seiner Karriere an Endoprothesen für Hüfte und Knie tüftelte, die Vorstellung einer Welt, in der das datengetriebene Krankenhaus Wirklichkeit wird. Der gebürtige Schwabe Trautwein erlebte, wie seine Mitarbeiter den Standort Leipzig bevorzugten. Aus Sachsen heraus wächst ein interkulturelles Team, das aus national festen und international freiberuflichen Experten besteht. Gearbeitet wird mittlerweile grenzüberschreitend, europaweit, quasi dezentral. Beschäftigte man sich zunächst ausschließlich mit KI-gestützter Bildanalyse, erkannte man schnell das enorme Potenzial, eine für die Durchführung klinischer Studien wichtige Anwendung auf einer eigens dafür geschaffenen Infrastruktur zu betreiben. Eine Plattform für die Datenaggregation wurde geschaffen, die heute ein Setting zur vollautomatisierten Durchführung klinischer Studien bietet. Die Messung des Patient-Outcomes kann so mit der KI-Bildanalyse kombiniert werden und Fachabteilungen wichtigen Aufschluss darüber geben, wie gut ihre Arbeit wirklich ist. Kliniken, vor allem in den USA, arbeiten mit den Schablonen aus Leipzig bereits und realisieren so eine einrichtungsinterne Qualitätssicherung nach wissenschaftlichen Standards der Medizintechnik. Die Medizintechnik selbst profitiert bei der Durchführung ihrer klinischen Studien. Der größte Teil des Umsatzes kommt aus dem Ausland. Was international auf hohen Zuspruch trifft, verhallt noch auf deutschen Krankenhausfluren, obwohl das junge Unternehmen das Vertrauen zahlreicher Industrie-Champions der Medizintechnik genießt. Als Konsortialführer gewann Trautweins Unternehmen Raylytic mit Weltmarktführern und weiteren Start-ups gerade erst den KI-Wettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums. Der Wettbewerb ist Teil der KI-Strategie der Bundesregierung. Das Projekt „Künstliche Intelligenz für Klinische Studien (KIKS)“ erhielt Anfang September den Zuschlag als förderwürdiges Vorhaben in der Branche Gesundheit.
Dieser kleine Exkurs zeigt, wie aufwendig es in Deutschland für gründende Jungunternehmer sein kann, sich national ins Gespräch zu bringen. Wo niemand aktiv sucht, ist ein enormer Kraftaufwand nötig, sich die Akzeptanz bei hiesigen Gesundheitsakteuren zu erarbeiten. Dabei muss vor allem auch der politische und gesellschaftliche Diskurs berücksichtigt werden. Mit europäischer Dimension steht die Medizintechnik gerade vor den enormen Herausforderungen zur Medical Device Regulation (MDR). Der Bundesgesundheitsminister arbeitet an einem Datenschutzgesetz in Ergänzung zum Digitale Versorgung-Gesetz. Deutschland findet gerade erst seinen Handlungsrahmen zum so wichtigen Datenaustausch personenbezogener Gesundheitsdaten. Denn dieser Handlungsrahmen ist nicht nur für die elektronische Patientenakte (ePA) notwendig. Er wäre auch hinreichend für den praktischen Erfolg des oben vorgestellten Projekts. Trotz des Erfolgs steht für die Partner eines international ausgerichteten, digitalen Ökosystems für klinische Daten immer wieder die Überwindung von Barrieren eines national unzureichend diskutierten und ausgelegten Regelwerks auf der Agenda.
Kulturelle Regelwerke für Innovationen
Die Einführung neuer Produkte in der Medizin, aber auch einer optimierten Diagnostik und verbesserter Therapieverfahren unter Berücksichtigung von Medizintechnik und pharmazeutischen Wirkstoffen ist geprägt von langen Entwicklungszyklen. So wird dem hohen Sicherheitsbedürfnis mit Blick auf Patientensicherheit und Haftungsrisiken entsprochen. Innovationen brauchen häufig Jahre und manchmal werden sie unter dem Einfluss von Marktveränderungen zwischenzeitlich sogar obsolet. Produkte altern immer schneller und teilweise ergeht das auch den tradierten Vorgehensweisen für medizinische Innovationen so. Wie lange es dauern kann, bis eine vielversprechende Therapie in den Katalog der Regelversorgung aufgenommen wird, ist ein bekanntes Phänomen. Die Zulassung eines Medikaments dauert oft Jahre. Die sorgfältige Abwägung, wie man mit begrenzten Ressourcen umgeht, um Neues hervorzubringen, hat seinen festen Platz im Gedächtnis der medizinisch-technischen und pharmazeutischen Industrie. Aber auch in Gesundheitseinrichtungen. Von der Smartpraxis sind wir gefühlt noch Lichtjahre entfernt. Krankenhäuser bauen zumindest erste Sandkästen, in denen sich neue Lösungen, die sich speziell dem stationären Treiben widmen, ausprobieren dürfen. Immerhin Krankenkassen tummeln sich heute schon an Innovationsplätzen, in denen Start-ups eine Pseudonähe zum Gesundheitsgeschehen der Zukunft genießen dürfen.
Eng verbunden mit der Zurückhaltung ist die Tatsache, dass ein einmal etabliertes Produkt seinen wirtschaftlichen Erfolg verlässlich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte entfalten muss. Im Krankenhaus sorgt jede innovative Störung für einen Ausnahmezustand, da einstudierte Routinen, die aufgrund von Fachkräftemangel und Einsparoffensiven verdichtet wurden, übertakten und eine Einrichtung schnell an ihre Belastungsgrenze bringen würde. Und selbst wenn der Wille da wäre, fehlte das Geld. Denn die Investitionen hinken den infrastrukturellen und basalen Notwendigkeiten mit großem Abstand hinterher. Mit einer zeitgemäßen Medizintechnik Schritt zu halten, scheint schon schwierig genug.
Gegensätzliche Philosophien
In immer komplexeren Marktumfeldern des globalen Wettbewerbs stehen Hersteller – egal welchen Produkts – mittlerweile vor neuen Herausforderungen. Als erstes haben das Softwarehersteller anerkennen müssen. Der Umgang mit Daten in einem exponentiellen stets größer werdenden Möglichkeitsraum verlangte schon vor vielen Jahren nach kürzeren Iterationszyklen, sodass für Design und Umsetzung von Innovationen ein neuer kultureller Umgang gefunden werden musste. Und jetzt wird auch die Medizin selbst immer datengetriebener. Die Medizin ist dabei zu entstofflichen. Die Datenmedizin formuliert viele Hoffnungen. Ob die eintreten, liegt auch am Umgang mit Daten allgemein. Derzeit liegen die Daten noch in den Gesundheitseinrichtungen und niemand weiß, wie man sie befreien könnte. Was ein Krankenhaus betrifft, entstehen Innovationen nicht im Krankenhaus-Informationssystem. Obwohl auch hier international einiges passiert. Cerner gab jüngst für die USA die Partnerschaft mit Amazon bekannt, um mithilfe deren AWS-Cloud das eigene Machine Learning voranzutreiben.
Viele der heutigen Start-ups, vor allem jene, die sich den datengetriebenen Szenarien der Medizin annehmen, sind erst mit dieser neuen Kultur entstanden und tragen in ihrer DNA einen Quellcode für Innovationsfreude. Kaum ist ein Inkrement fertig, wird mithilfe fortschreitender Iterationen auf die Dynamiken am Markt reagiert. Immer seltener geht es dabei um Hardware. Eher begegnen sie dem User in zahlreichen Updates auf seinem Smartphone.
So setzte beispielsweise das Unternehmen Lifetime zu Beginn auf eine kleine Hardwarebox, die im Kern ein geschlossenes WLAN aufbaute, um den Datentransfer zwischen Arztpraxis und Smartphone des Patienten zu gewährleisten. Schnell erkannte das Unternehmen aus Hamburg, dass das alles mit Software viel einfacher gelingen kann. Die Akzeptanz dafür stieg. Heute passiert das alles ohne Box durch ein hochverschlüsseltes, softwaregestütztes Verfahren, das kein haptisches, blinkendes Artefakt mehr benötigt. Zwischen beiden Paradigmen lagen nur wenige Wochen. Ein sehr kurzer Parallelbetrieb aus Box und Software wurde vor Kurzem eingestellt. Währenddessen gilt die Gesundheitskarte mit der verpflichtenden Einführung des Konnektors zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur nach mehr als einer Dekade alles andere als abgeschlossen. In Einzelfällen sabotiert der Konnektor sogar den Praxisbetrieb, weil er die Netzwerkinfrastruktur stört. Das von der Bundesregierung initiierte Gesamtvorhaben wurde der Selbstverwaltung aus den Händen genommen. Mit dem Versprechen, dessen Entwicklung in zeitgemäße Bahnen zu lenken.
Wie sich das Kapital seinen Weg sucht
Freilich, innovative Ideen im Gesundheitsgeschehen entscheiden sich auch am Geld. Volkswirtschaftlich gesehen steckt noch zu viel Kapital in den anachronistischen Ecken der Wirtschaft. Zum Beispiel dort, wo es um Erhaltungsinnovationen geht (vgl. Automobil). Gerade das deutsche Gesundheitswesen gilt nach wie vor als eines der besten der Welt. Gesundheitspolitiker lassen keine Gelegenheit aus, das Schützenswerte zu betonen. Doch auch hier lassen sich im internationalen Kontext Veränderungen feststellen. In Entwicklungsländern ist mit Blick auf die Organisation des Gesundheitsgeschehens häufig das sogenannte Leapfrogging zu beobachten: das freiwillige Auslassen oder Überspringen üblicher Entwicklungsstufen. Leapfrogging ist weniger Zufall als vielmehr Kalkül ganzer Nationen, um Anschluss an den Rest der Welt zu nehmen. Und das geht Hand in Hand mit der sich aufgrund des technischen Fortschritts wandelnden Geisteshaltung der jeweiligen Gesellschaften. In Indien gehört die Videosprechstunde trotz widrigster technischer Umstände seit Jahren zur Normalität. Das größte Potenzial sehen Analysten dort, wo es quasi kein Geld, nur wenig Ärzte, aber massenhaft Mobiltelefone gibt. Digitale Gesundheitsanwendungen werden dort bevorzugt, weil diese nicht nur Einsparungen, sondern vor allem auch Fortschritt versprechen, der zudem nicht so lange Zeit in Anspruch nimmt und in sich dynamischere Sprünge verspricht. Sprünge, die bald schon ausreichen könnten, dass Länder, die aus unserer Sicht noch in der Entwicklung stecken, in Güte und Wirksamkeit bei Gesundheitsfragen vor uns liegen.
Für Start-ups hierzulande ist das eine besondere Herausforderung. Denn damit offenbart sich, wie aggressiv Veränderung daherkommt. Einerseits ist man gut beraten, die Errungenschaften des hiesigen Gesundheitswesens zu würdigen. Andererseits ist man nicht mit dem Faktor Zeit ausgestattet. Start-ups werden als ungeduldig wahrgenommen; in Anbetracht der Behäbigkeit im Reaktionsvermögen unseres Gesundheitssystems auf Veränderungen verständlich. Auf die mentalen Annäherungen der Akteure zu warten, kann grausam sein. Vor allem für den Gründer, der sich monatelang mit den technischen und rechtlichen Details für eine Online-Videokonsultation herumschlägt, dann auf den Widerstand der zentralen Zielgruppe für seine Lösung stößt und später doch diesen einzelnen Arzt trifft, der damit kokettiert, er praktiziere die Videosprechstunde schon seit mehr als zehn Jahren mithilfe von Skype und frage nicht, wem das passe oder nicht. Wer würde sich da nicht fragen, warum das richtige Tun ein falsches Erleben erzeugt.
Zurück zu den mit dem DVG gedachten Möglichkeiten der Krankenkassen, sich dem Markt für innovative Versorgungslösungen zuzuwenden: Die Investitionsvolumen, die Krankenkassen mit der zwei-Prozent-Regel zur Verfügung gestellt bekommen, um sich aktiv einmischen zu können, liegen bei den wenigsten Kassen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Gesetzgeber möchte offenbar, dass sich Krankenkassen nicht nur belesen, verbal ereifern oder sogenannte Hubs bauen, um sich mit der Aura innovativer Versorgungsansätze zu umgeben. Er will, dass die Krankenkassen raus in die Welt gehen und selbst lernen. Zumindest innerhalb von Europa. Laut Referentenentwurf erhalten Krankenkassen durch den Erwerb von Anteilen zum Beispiel an einem Wagniskapitalfonds in Kombination mit einer fachlich-inhaltlichen Kooperation die Möglichkeit, das Marktumfeld besser kennenzulernen. Damit soll auf die Förderung und Entwicklung innovativer Ansätze im Gesundheitswesen abgezielt werden, und diese Ansätze sollen dann – eben mithilfe der Krankenkasse und ihrer Gesundheitsbeziehung zur Bevölkerung – für das deutsche Gesundheitssystem nutzbar gemacht werden. Vielleicht würde es manchem Start-up helfen, wenn ein Teil des nach dem DVG verfügbaren Geldes in die nachweisliche Erneuerung der Innovationskultur im deutschen Gesundheitswesen gesteckt werden müsste.
Hinweis: Der Autor (Gründer der HEALZZ.community mit mehr als 27.000 Mitgliedern und Director Hospital & Health der Kommunikationsagentur Edenspiekermann) berät unter anderem das erwähnte Start-up Raylytic in Marketingfragen.